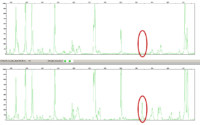Frau Hasse, warum haben Sie sich für den Studiengang Biotechnologie entschieden? Warum wollten Sie das gerade in Mittweida studieren?
Frau Hasse, warum haben Sie sich für den Studiengang Biotechnologie entschieden? Warum wollten Sie das gerade in Mittweida studieren?
Ein reines Biologiestudium kam für mich nicht in Frage, da mich Fächer wie Botanik zum Beispiel überhaupt nicht interessieren. Außerdem mag ich eher ein anwendungsorientiertes Studium, bei dem man Grundlagen lernt und sie anwendet. Bei reinen Biologiestudiengängen sieht es da ja etwas anders aus. Seitenweises Auswendiglernen macht mir weniger Spaß als Lösungen für bestehende Probleme zu finden.
An der Hochschule Mittweida fand ich es reizvoll, dass der Studienschwerpunkt eher in der ingenieurtechnischen Ausbildung lag. Andere Hochschulen legen den Fokus auf die Biologie und reißen den Technikanteil nur kurz und oberflächlich an. Natürlich hat man auch mal in der Vorlesung gesessen und sich gefragt, warum man das jetzt unbedingt wissen muss, weil man das große Gesamtbild noch nicht gesehen hat. Im Nachhinein muss ich jedoch sagen, dass mir so gut wie jedes unterrichtete technische Fach bei meiner täglichen Arbeit hilft, auch wenn ich natürlich nicht mehr irgendwelche Transformationen ausrechnen muss. Allein das Wissen darum und das technische Grundverständnis erleichtert mir die Arbeit und vor allem das Zusammenarbeiten mit Elektrotechnikern und Maschinenbauern anderer Firmen, da ich quasi die Schnittstelle zwischen den Biologen und den Technikern beziehungsweise Informatikern bin.
Welche vor dem Studium erworbenen Qualifikationen haben Sie für dieses als nützlich empfunden?
Ich denke, dass ein technisches, mathematisches als auch physikalisches Grundverständnis für das Studium – vor allem für das Grundstudium – wichtig gewesen ist. Ohne das wäre es sicherlich auch machbar gewesen, da man zu Beginn der Vorlesungen von den Professoren auf die Grundlagen, die man bereits haben sollte beziehungsweise nachholen musste, hingewiesen worden ist. Dadurch konnten auch Studenten, die kein naturwissenschaftliches Abitur hatten das Studium erfolgreich bestehen, jedoch ist der Lernaufwand dieser Studenten wesentlich höher gewesen, da das Studium sehr anwendungsorientiert ist und man die Grundlagen also im Schlaf beherrschen musste. Wesentlich mehr Qualifikationen brauchte man nicht unbedingt. Während des Studiums habe ich mich zum ersten Mal mit Microsoft Excel und Powerpoint sowie mit Adobe Photoshop auseinander gesetzt und fand das schrittweise Heranführen vor allem durch Vorträge sinnvoll. Im Nachhinein betrachtet und vor allem auch im Hinblick auf mein zweites Studium an der TU Dresden hätte ich mir jedoch weitaus mehr Vorträge und mündliche Prüfungen gewünscht, auch wenn man diese in dem Moment gehasst hat. Für den beruflichen Werdegang schadet es auf jeden Fall nicht, im freien Reden und in Vorträgen vor Publikum trainiert zu sein.
Wie haben Sie die Wohnsituation in Mittweida erlebt? Wo haben Sie während des Studiums gewohnt?
Ob eine WG oder eine eigene kleine Wohnung auf der Bahnhofstraße, das Wohnen und Studieren in Mittweida hat sehr viel Spaß gemacht. Gerade weil es sich um eine kleine Hochschule mit nur wenigen Studenten handelt. Man kennt sowohl seine Seminargruppe als auch Studenten aus anderen Jahrgängen und Studienrichtungen. Dies hat zum einen die verschiedenen Vorlesungen erleichtert, weil man auch andere Studenten um Hilfe bitten konnte, als auch das Partyleben und die Gruppenbindung innerhalb der Seminargruppe. Man ist eben nicht nur eine Nummer gewesen, sondern ein Mensch. Und wenn in den Sommersemesterferien mal keiner da gewesen ist, pilgerte man einfach zur Mensa und hat dort recht leicht neue Leute kennen gelernt, mit denen man etwas unternehmen konnte. Bei meinem zweiten Studium an der TU Dresden ist das definitiv nicht so einfach gewesen, denn dort waren alle Studenten quer über die gesamte Stadt verteilt und gingen an verschiedenen Orten Essen.
Wie haben Sie das Verhältnis zwischen Studenten und Professoren empfunden? Waren die Professoren gut erreichbar?
Definitiv. Dies ist ein großer nicht zu vernachlässigender Vorteil der Hochschule Mittweida. Vor allem auch, dass viele Professoren und Seminarleiter die Namen der gesamten Seminargruppe kannten. Klar hat das den Druck, die Seminaraufgaben zu erledigen und während der Vorlesung dem Professor zu folgen, erhöht. Dies hat sich aber spätestens bei der Prüfungsvorbereitung ausgezahlt. Wenn ich noch einmal studieren würde, dann definitiv wieder an einer Hochschule mit familiärem Charakter und nicht an einer Massenuniversität. Ich mochte es, ohne einen drei Wochen vorher vereinbarten Termin zum Professor gehen zu können. Vor allem während der Prüfungszeit war das von Vorteil, da sich dort Fragen meistens erst kurzfristig ergeben haben.
Gab es nach dem Studium Unsicherheiten bei der Berufswahl oder eine Phase der Orientierungslosigkeit? Wie haben Sie diese überwunden?
Dadurch, dass das Praxissemester bereits im dritten Studienjahr stattfand, eigentlich nicht. Man knüpfte erste Kontakte, probierte sich aus, fand anschließende Stellen als wissenschaftliche Hilfskraft und entwickelte sich weiter, bis sich schließlich ein Gesamtbild zusammenfügte.
Warum haben Sie sich für das Max Planck Institut als Arbeitgeber entschieden?
Am Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik arbeitete ich sowohl schon während meines Studiums in Mittweida als auch während meines Masterstudiums an der TU Dresden. Nach meinem Auslandsaufenthalt suchte ich anschließend an meinen Master eine Stelle in Dresden. Über Kontakte erfuhr ich dann, dass sowohl mein derzeitiger Chef als auch eine Screeningfirma einen Mitarbeiter im Bereich der Laborautomation suchten. Auf diesem Gebiet hatte ich bereits schon sowohl meine Diplom- als auch meine Masterarbeit geschrieben. Da es am Max-Planck-Institut das interessantere Projekt mit mehr Verantwortung und höheren Aufstiegschancen gab, entschied ich mich für das Institut.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Die Laborautomation ist für viele Biologen ein unbekanntes Feld. Im Prinzip nutzen wir Pipettierroboter und automatische Mikroskope um die Experimente, die die Biologen manuell machen, im Hochdurchsatz durchzuführen, um so ganze Genome zu screenen.
Da ich für die gesamte Laborautomation des Gebäudes zuständig bin, ist mein Arbeitstag selten planbar und dementsprechend spannend. Im Prinzip schreibe ich neue Programme für die Pipettierroboter und bin dafür zuständig, dass sowohl die Roboter, als auch die automatisierten Mikroskope das machen, was sie machen sollen – was leider nicht immer der Fall ist, da wir es oft mit Geräten im Beta-Status zu tun haben, die Technik also noch nicht komplett ausgereift ist. Hier kommt mir vor allem der ingenieurtechnische Teil meines Mittweidaer Studiums zugute, da ich viel mit Softwareprogrammierern und Technikern der Herstellerfirmen zusammenarbeite um Lösungen zu finden.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen?
Die Zusammenarbeit am Max-Planck-Institut mit Vorgesetzten ist recht entspannt, da sich alle per Du anreden und niemand mit „Prof. Dr. Dr.“ angeredet werden möchte. Über meine Vorgesetzten erfahre ich, was sie erforschen wollen, schlage ihnen Möglichkeiten für die Automation des Prozesses vor und realisiere sie dann auch. Mit meinen Kollegen arbeite ich dahingehend zusammen, dass ich sie an den Geräten mit dem spezifischen automatisierten Prozess anlerne, damit sie diesen dann selbstständig ausführen und mich lediglich im Störfall informieren, damit ich mich um die Reparatur des Gerätes kümmern kann. Kleine Sachen repariere ich dann selbst, bei komplexeren muss natürlich ein Techniker der Herstellerfirma hinzugezogen werden.
Was würden Sie als Ihren größten beruflichen Erfolg bisher bezeichnen?
Das ist schwer zu sagen, da es bisher glücklicherweise keine Rückschläge gegeben hat. Stolz macht mich auf jeden Fall, dass ich nach meinem Dipl.-Ing. (FH) an der Hochschule Mittweida meine Masterarbeit an der Yale University in den USA geschrieben habe, dass ich sofort im Anschluss an mein Studium einen Job gefunden habe, in dem meine Vorgesetzen so zufrieden mit mir sind, dass ich nach zwei Jahren zum Kopf der Automationseinheit des Institutes wurde und frei über meine Arbeitseinteilung verfügen kann.
Wem würden Sie einen Job in Ihrer Branche empfehlen?
Definitiv jedem, dem die reine Biologie zu langweilig ist. Forschen im kleinen Maßstab macht definitiv viel Spaß, nur bin ich eher der zielorientierte Typ. Ich möchte nicht unbedingt in jahrelanger Kleinstarbeit herausfinden, was das Protein A im Prozess B macht und wie es mit anderen Proteinen unterschiedliche Prozesse beeinflusst. Für mich persönlich ist es interessanter diese Zusammenhänge im Hochdurchsatz in kurzer Zeit herauszufinden. Zusätzlich ist die Automation auch noch eine gute Abwechslung zur reinen Biologie, was meinen Alltag wesentlich vielfältiger macht. Ein weiterer Vorteil mit einem Dipl.-Ing. (FH) in der Automation zu arbeiten, ist auch, dass man nicht unbedingt einen Doktortitel benötigt, was bei einem reinen Biologiestudium normalerweise im Anschluss an das Studium ansteht.
 Seit dem zweiten Semester begleiteten mich regelmäßig die Praktika mit der Biotechnologie. Nach anfänglichen Berührungsängsten, war das Praktikum das Highlight und alle zwei Wochen eine willkommene Abwechslung. Ich kann mich noch gut an eines meiner ersten Praktika erinnern, als wir mit Hilfe von Hefen Alkohol hergestellt haben. Die kleinen Hefen wurden in Calciumalginat eingeschlossen (immobilisiert) und sahen mit etwas Fantasie aus wie kleine Planeten, die in einem Zuckerwasser-Universum ihre Bahnen kreisten. Jede Hefe, die aus der Hülle heraus knospte, war wie ein Astronaut der sich auf den Weg ins weite Universum machte.
Seit dem zweiten Semester begleiteten mich regelmäßig die Praktika mit der Biotechnologie. Nach anfänglichen Berührungsängsten, war das Praktikum das Highlight und alle zwei Wochen eine willkommene Abwechslung. Ich kann mich noch gut an eines meiner ersten Praktika erinnern, als wir mit Hilfe von Hefen Alkohol hergestellt haben. Die kleinen Hefen wurden in Calciumalginat eingeschlossen (immobilisiert) und sahen mit etwas Fantasie aus wie kleine Planeten, die in einem Zuckerwasser-Universum ihre Bahnen kreisten. Jede Hefe, die aus der Hülle heraus knospte, war wie ein Astronaut der sich auf den Weg ins weite Universum machte.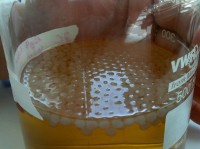 Durch etwas Vorbereitung, konnten während des Praktikums Fragen gewinnbringend diskutiert werden und stärkten somit den Teamgeist, nicht nur zwischen Kommilitonen, sondern auch zwischen den Lehrkräften und unserer Praktikumsgruppe. Gut fand ich auch, dass die Praktikumsgruppen immer selber bestimmt werden konnten, getreu dem Motto “Never change a running system”. Im Praktikum misslungene Versuche durften wir in unserer Freizeit freiwillig wiederholen und auch mit eigenen interessanten Experimenten waren wir immer willkommen. Unsere Praktikumsgruppe hat zum Beispiel die Wasseranalyse eines kleinen Sees in unserer Nähe (Torfgrube) durchgeführt und für unsere Bergfestspiele den pH-Wert von Säften oder anderen Getränken neutralisiert, sodass lustige Geschmacksrichtungen entstanden sind und die ursprünglichen Getränke nur sehr schwer zu erraten waren.
Durch etwas Vorbereitung, konnten während des Praktikums Fragen gewinnbringend diskutiert werden und stärkten somit den Teamgeist, nicht nur zwischen Kommilitonen, sondern auch zwischen den Lehrkräften und unserer Praktikumsgruppe. Gut fand ich auch, dass die Praktikumsgruppen immer selber bestimmt werden konnten, getreu dem Motto “Never change a running system”. Im Praktikum misslungene Versuche durften wir in unserer Freizeit freiwillig wiederholen und auch mit eigenen interessanten Experimenten waren wir immer willkommen. Unsere Praktikumsgruppe hat zum Beispiel die Wasseranalyse eines kleinen Sees in unserer Nähe (Torfgrube) durchgeführt und für unsere Bergfestspiele den pH-Wert von Säften oder anderen Getränken neutralisiert, sodass lustige Geschmacksrichtungen entstanden sind und die ursprünglichen Getränke nur sehr schwer zu erraten waren.